Was wenn Rechtsextremismus in der Kita zum Thema wird? Zum Beispiel, weil Eltern, Kinder oder Kolleg*innen durch rechtsextremistische Ideologie auffallen? Gedanken und Tipps für pädagogische Fachkräfte in der Kita.
Die Zusammenarbeit mit Eltern gehört für die pädagogischen Fachkräfte in der Kita zum Alltag. Denn nur durch eine entsprechende Kooperation können Erzieher*innen ihren Bildungsauftrag wirklich erfüllen. Doch was, wenn Eltern oder Kinder durch rechtsextremistische Ideologien auffallen? Das betrifft dann ja nicht mehr nur das eigene Kind, sondern die ganze Kita.
Was, wenn Eltern von Kita-Kindern rechtsextrem sind?
Die Eltern versuchen zum Beispiel Einfluss auf andere Eltern zu nehmen. Vielleicht sagen sie ihren Kindern, dass sie bestimmte andere Kinder meiden oder ausgrenzen sollen. Vielleicht verhalten sie sich auch diskriminierend gegenüber manchen Eltern oder tragen Kleidung bestimmter Marken, rechtsextreme Symbole oder Tatoos. Oder vielleicht sind es die Kinder, die sich im Spiel auffallend verhalten oder manche Kinder abwertend und ausgrenzend behandeln.
Dann stehen Kitas und ihre Mitarbeitenden teilweise vor schwierigen Herausforderungen. Einerseits sollen ja gerade diese Kinder in einer Kita die Möglichkeit erhalten zu erfahren, wie es ist, sich offen und solidarisch in eine Gemeinschaft zu integrieren. Andererseits müssen die anderen Kinder und Eltern vor möglicher Einflussnahme oder Diskriminierung und nicht zuletzt auch der Ruf der Einrichtung geschützt werden.
Das Kompetenznetzwerk für Demokratiebildung im Kindesalter hat eine Broschüre mit dem Titel „Rechtsextremismus als Thema in der Kita“ herausgebracht, dass hierbei Unterstützung liefert. Demnach sind Fragen, die in so einer Situation helfen können, einen guten Weg zu finden, zum Beispiel:
- Wie kommt man mit diesen Eltern ins Gespräch?
- Sollte dieses Thema auch mit den anderen Eltern besprochen werden und wenn ja, wie?
- Was können Kitas im Umgang mit diesen Eltern und den Kindern voneinander lernen?
- Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote gibt es?
Warum Sexismus eine besondere Rolle spielt
Prof. Dr. phil. Esther Lehnert, Pädagogin, Professorin für Theorie, Geschichte und Praxis Sozialer Arbeit an der Alice Salomon Hochschule Berlin (www.ash-berlin.eu) und tätig für die Amadeu Antonio Stiftung (www.amadeu-antonio-stiftung.de/) warnt davor, dass Rechtsextremismus meistens mit Männern in Verbindung gebracht wird. Das mache es Müttern besonders leicht, rechtsextremes Gedankengut in Kitas einzuschleusen.
„Wohl überlegt versuchen diese Mütter in einem ersten Schritt gegenüber den Fachkräften und den anderen Eltern Vertrauen aufzubauen. Sie bringen sich zu vielen Gelegenheiten positiv ein, beteiligen sich an den Kitafesten, übernehmen Putzdienste und stellen sich als mögliche Begleitung für Ausflüge zur Verfügung. Wenn ihnen der Beziehungsaufbau geglückt ist, beginnen sie nach und nach ihre Ideologie einzubringen, wenn sie sich beispielsweise für das Singen deutscher Kinderlieder aussprechen oder dafür plädieren, Bilder von der Wand zu entfernen, da die Kinder darauf vermeintlich nicht „deutsch“ aussehen, in ihren Unterhaltungen immer öfter rassistische Zuschreibungen einflechten oder gar Kinderbücher mit antisemitischen oder rassistischen Inhalten mit in die Einrichtung bringen“, schreibt sie in der oben genannten Publikation. Gleiches gilt natürlich auch für rechtsextreme Kolleg*innen.
Ganz generell gilt aber: Weil rechtsextreme Eltern und Erzieher*innen natürlich auch herzlich und fürsorglich sein können, fallen rechtsextreme Ansichten nicht immer sofort auf. Ihre schädliche Wirkung verbreiten sie dennoch. Deshalb ist es laut Lehnert wichtig, dass sich pädagogische Fachkräfte auf dem Laufenden sind, was Einstellungen, Codes und Erscheinungsformen des modernen Rechtsextremismus ausmacht. Die Vorstellung, dass Rechtsextreme immer martialisch auftreten und sich auf keinen Fall für ökologische Landwirtschaft interessieren stimmt zum Beispiel schon lange nicht mehr. Eine der heutigen Strategien Rechtsextremer setzt genau auf die „Normalisierung“, also darauf, nicht als rechtsextrem aufzufallen.
Kitas im Dilemma
In der kostenlosen PDF-Broschüre werden drei reale Fallbeispiele aus unterschiedlichen Kitas vorgestellt. Sie zeigen: Pädagogische Fachkräfte in einer Kita befinden sich in einem Dilemma, wenn es zu Rechtsextremismus in der Kita kommt.
Wichtig ist, dass die pädagogischen Fachkräfte alle Kinder – unabhängig von ihrem Verhalten – das gleiche Recht auf Anerkennung, Wertschätzung und Forderung zugestehen. Das heißt, sie wollen jedes Kind inkludieren. Gleichzeitig müssen sie aber auch möglich sofort und deutlich klar machen, dass diskriminierendes, verletzendes Verhalten nicht akzeptabel ist und ausgeschlossen ist. Dazu ist es wichtig, dass pädagogische Fachkräfte ein Kind mit rechtsradikalen, rassistischen Verhaltensweisen nicht pauschal verurteilen und als „das Problem“ betrachten. Sondern dass sie auch bei diesem Kinder zeitgleich die Stärken, Potentiale und den Gesamtkontext erkennen, in dem das Kind steckt und handelt.
Bei den Eltern sieht es ähnlich aus: zwar sollten Erziehende unmissverständlich klar machen, dass menschenverachtende, rassistische und diskriminierende Haltungen und Codes in der Kita mit null Toleranz behandelt werden. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, die Eltern in ihrer Elternrolle anzuerkennen und eine wertschätzende Zusammenarbeit bei der Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder zu erreichen.
Der Umgang mit Rechtsextremismus in der Kita
Aus den drei Fallbeispielen haben die Autor*innen mehrere Punkte heraus gearbeitet, die für die Kitas und pädagogischen Fachkräfte in allen Fällen hilfreich waren:
- Die Sensibilisierung ist wichtig. Die Fachkräfte müssen die Fähigkeit haben, rechtsextreme Symbole, Praktiken und Argumente als solche überhaupt er einmal zu erkennen. Das ist keineswegs immer leicht für sie.
- Die Problematisierung muss dem sensiblen Wahrnehmen folgen. Dabei müssen die pädagogischen Fachkräfte in der Lage sein, die Komplexität der gesamten Situation zu verstehen und professionell auf Kinder, Eltern und das Team zuzugehen.
- Die Kollektivierung bedeutet, dass pädagogische Fachkräfte nicht versuchen, die Situation alleine zu lösen. Es ist wichtig, dass sich Erzieher*innen in jedem Fall eine kollegiale Beratung suchen bzw. ein kompetentes System für die Reflexion haben.
- Die Positionierung zeigt sich darin, dass Fachkräfte und Team eindeutig, angstfrei und ethisch-moralisch begründet eine Position gegen rechtsextreme Phänomene einnehmen. Das gilt sowohl den Eltern und Kolleg*innen, als auch den Kindern gegenüber.
- Die Vernetzung mit weiteren Institutionen in der Umgebung, Kommune etc. trägt dazu bei, dass Erfahrungen ausgetauscht und eine kollegiale Beratung erfolgen kann. Langfristig geht es darum, dass Kitas ein tragfähiges und nachhaltiges Konzept im Umgang mit Rechtsextremismus in der Kita entwickeln, um sie zu einem sicheren Ort für alle zu machen.
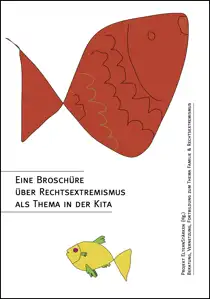
Details
Titel: Eine Broschüre über Rechtsextremismus als Thema in der Kita
Herausgebende: Eva Prausner und Kerstin Palloks
Umfang: 52 Seiten
Preis: Kostenloser Download
Auf KITA-GLOBAL finden Sie weitere Beiträge passend zu diesem Thema:
- Vorurteilen und Diskriminierung in der Kita begegnen: https://kita-global.de/vorurteilen-und-diskriminierungen-in-der-kita-begegnen/
- Wie erkläre ich Kindern Rassismus? https://kita-global.de/wie-erklaere-ich-kindern-rassismus/
- Audio-Interview: Antirassismus in der Kita: https://kita-global.de/audio-interview-antirassismus-in-der-kita/
- Vorurteilsbewusstes Spielzeug: https://kita-global.de/vorurteilsfreies-spielzeug/

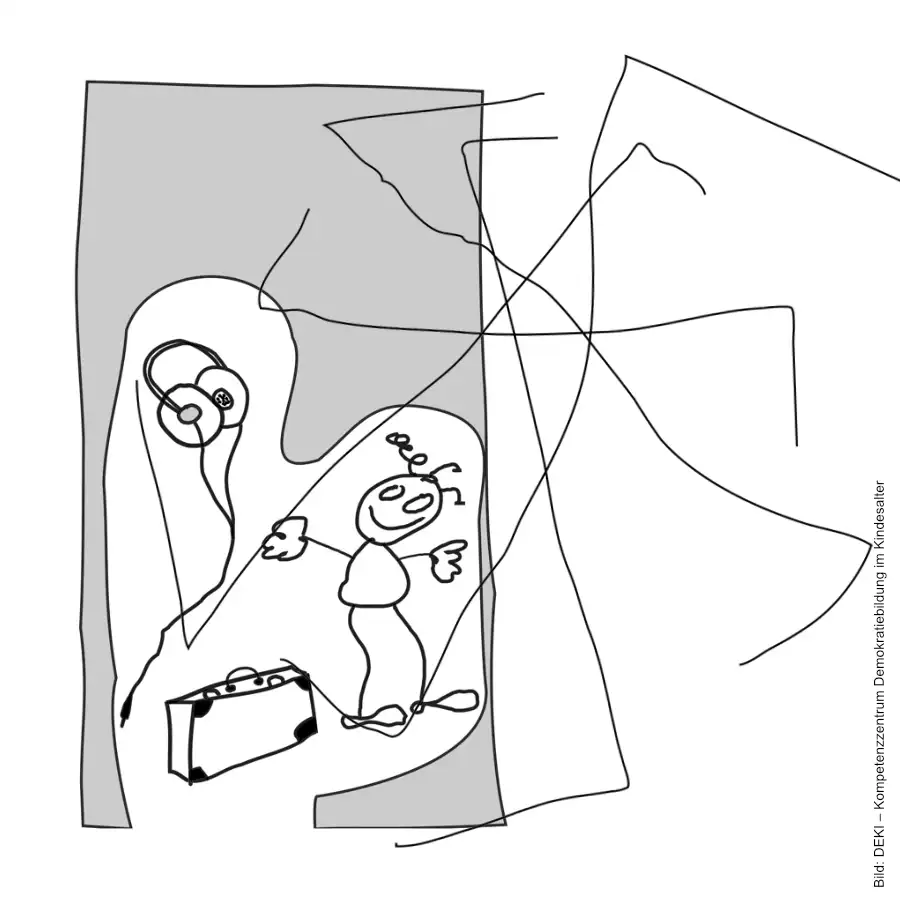




Hinterlassen Sie einen Kommentar